Der Heilige Hieronymus | Übersetzung der Bibel aus dem Griechischen ins Lateinische
- Holger Hedrich
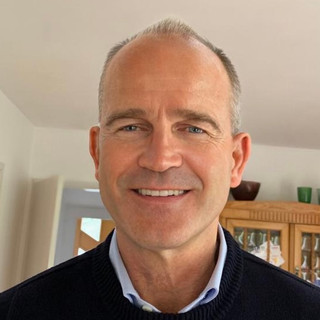
- 16. Sept. 2024
- 3 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 28. Sept. 2024
Diese kleine, beidseitig bemalte Tafel wurde höchstwahrscheinlich für den privaten Gebrauch hergestellt. Sie war als tragbares Objekt gedacht und konnte in den Händen des Besitzers umgedreht werden, um beide Seiten betrachten zu können. Auf der Vorderseite ist der heilige Hieronymus abgebildet, der vor einem Kruzifix kniet, das in einem Baumstumpf steckt. Hieronymus war ein Gelehrter, dessen größte Leistung darin bestand, die Bibel, die er in seiner rechten Hand hält, aus dem Griechischen ins Lateinische zu übersetzen. Dieser Text, die so genannte Vulgata, wird noch heute von der römisch-katholischen Kirche verwendet. Um seinen Beitrag für die Kirche zu würdigen, wurde Hieronymus oft mit dem Gewand und dem breitkrempigen Hut eines Kardinals dargestellt, obwohl es dieses Amt zu seinen Lebzeiten noch nicht gab. Auf diesem Gemälde liegen sie vor ihm auf dem Boden.
Der Legende nach lebte Hieronymus als Einsiedler in der Wüste bei Bethlehem, wohin er sich vor den weltlichen Versuchungen Roms zurückgezogen hatte. Dort warf er sich, wie es in seinen Schriften heißt, „Jesus zu Füßen ... und hörte nicht auf, an seine Brust zu schlagen, bis Ruhe in mich einkehrte“. Diese Praxis sollte Mitleid mit dem Leiden Christi wecken. Auch der Löwe, der hier neben ihm ruht, ist ein häufiges Motiv auf Bildnissen des Heiligen; Hieronymus zog dem Löwen einen Dorn aus der Pfote, und von diesem Tag an wich das Tier nicht mehr von seiner Seite.
Hieronymusbilder waren in Italien sehr beliebt, aber in Dürers Heimat Deutschland bis dahin weitgehend unbekannt. Mit ziemlicher Sicherheit malte der Künstler das Bild nach seiner Rückkehr aus Venedig, wohin er 1495 gereist war. Dürers Version der Wüste - oder Wildnis - ist ausgesprochen nordeuropäisch. Die Figur des Heiligen wirkt winzig vor einer weiten Landschaft aus schroffen Felsen, die mit Nadel- und Laubbäumen bewachsen sind, von denen einige sogar aus den Felsspalten ragen. Das bewaldete Gebiet am linken Bildrand umschließt den gotischen Turm einer Kirche, dessen Spitze mit den Gipfeln der fernen, schneebedeckten Bergkette korrespondiert. Die alpine Umgebung ist eindeutig von Deutschland inspiriert und erinnert an die zahlreichen detaillierten Aquarellstudien, die Dürer direkt vor der Natur anfertigte. Diese Studien sind Ausdruck seines Interesses an der Natur und seiner intensiven Beschäftigung mit ihren kleinsten Elementen. Die Gräser und Blumen um Hieronymus' Knie beispielsweise sind genau beobachtet und umfassen eine Reihe verschiedener Arten. Zwei kleine Distelfinken sitzen am Ufer eines Baches, einer von ihnen trinkt daraus (der Vogel war traditionell ein Symbol für die Passion Christi). Der Löwe stammt wahrscheinlich aus einer Studie auf Pergament (heute im Kupferstichkabinett der Hamburger Kunsthalle), die Dürer 1494 anfertigte, auch wenn der Löwe hier eher stehend als liegend dargestellt ist. Die feinen Haare der Löwenmähne werden vom Sonnenlicht ebenso hervorgehoben wie der weiche, zottelige Bart des Hieronymus.

Das helle Gelb des Sonnenuntergangs (oder Sonnenaufgangs) beherrscht das Bild und verstärkt mit seiner blendenden Leuchtkraft die Intensität des Gebets des Hieronymus. Über den Wolken wird es zu einem Pfirsichton und dann zu einem sanften Rot. Die Wolken sind dunkel und unheilverkündend und erzeugen zusammen mit der üppigen und ungezähmten Natur eine gespannte und dramatische Atmosphäre. Dürer war durch sein Studium der venezianischen Malerei, insbesondere der Werke Giovanni Bellinis, mit den stimmungsbildenden Möglichkeiten des Lichts vertraut.

Das Gefühl der Vorahnung, das durch den aufgewühlten Himmel im Bild des Heiligen Hieronymus hervorgerufen wird, setzt sich auf der Rückseite des Blattes fort, wo ein Himmelskörper mit einem rot leuchtenden Schweif vor einem dunklen Nachthimmel zu sehen ist; es bleibt unklar, ob es sich um einen Kometen, einen auf die Erde stürzenden Meteoriten oder eine Sonnenfinsternis handelt. Das Bild wurde als Darstellung des Weltuntergangs gedeutet, wie er in der Offenbarung des Evangelisten Johannes beschrieben wird. Zahlreiche Gemälde von Hieronymus aus dem 15. und 16. Jahrhundert enthalten Anspielungen auf das Jüngste Gericht, denn nach mittelalterlichen Texten galt er als dessen Prophet, da er die Posaunen als Zeichen des Gerichts Christi am Ende der Welt gehört hatte (Offenbarung 8:6-9:21). Die Rückseite könnte dann eines der sechs Zeichen der Apokalypse darstellen, die Johannes offenbart wurden: „Die Sonne wurde schwarz wie ein härenes Sackkleid, und der ganze Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Winterfrüchte abwirft, wenn er von einem heftigen Sturm geschüttelt wird“ (Offb 6,12-13).



Kommentare